Die Wiederentdeckung der Sphären
Eine neue Gewaltenteilung
Die Monokultur des herkömmlichen Parlamentarismus, sie steht in
einem Missverhältnis zur gesellschaftlichen Realität. Denn die
ist in der Moderne – so eine soziologische Binse – eine
zunehmend komplexe, die sich in soziale Teilsysteme
ausdifferenziert.
1
Die Sphäre des Rechts hat
es dabei sogar so weit gebracht, als autonome Ordnung neben der
Politik anerkannt zu werden.
2
Aber auch
Arbeit, Wohnen, Verbrauch und Vorsorge stellen vielschichtige
Bedürfnis- und Abhängigkeitswelten dar, die für das Leben und
Zusammenleben grundlegend sind.
3
Und doch
können die Bürger nur sehr indirekt auf ihre Ausgestaltung
Einfluss nehmen: nämlich über ihre politische Repräsentation im
Parlament. Also theoretisch. Praktisch folgen diese sozialen
Funktionsbereiche einer Eigendynamik, die sich mit den groben
Mitteln der allgemeinen Politik nicht beherrschen lässt. Zumal
sie sich seit der
neoliberalen Privatisierung
Neoliberalismus
Die Politik, die mit den bürgerlichen Freiheiten spielt
noch mehr dem Zugriff der Volksvertretung entziehen.
4
Vielmehr herrscht in diesen Sphären, die den Charakter unseres
Gemeinwesens prägen, der Wind einer feudalen Ordnung. Sie werden
zugerichtet durch Konzentrationen der Macht, auf deren
Bereitstellungen wir angewiesen sind, ohne unsere Interessen
wirklich geltend machen zu können. Die Souveränitätsrechte, die
den Bürgern in der politischen Sphäre zukommen, gelten nicht in
den sozialen Sphären. In unserer Rolle als Arbeiter, Mieter,
Verbraucher oder Vorsorger fungieren wir vor allem als
Untertanen.
5
»Wie wir arbeiten, wie wir wohnen, was wir verbrauchen und wie wir vorsorgen, das sind keine Nebensächlichkeiten im Leben. Es sind systemische Elemente, deren Arrangement über das Schicksal der Gesellschaft entscheidet.«
Wenn die Demokratie ihren Kinderschuhen entwachsen will, müsste
sie also lernen, auch ihre repräsentativen Strukturen nach
funktionalen Gesichtspunkten zu gliedern. Zwar stellt sie bisher
einen rechtsstaatlichen Rahmen bereit, um der größten Willkür
mit individuellen und zum Teil auch kollektiven Rechten zu
begegnen.
6
Doch das aufklärerische Ideal, in
dem Gesetzgeber und Gesetzesadressat identisch sind, wie
Ingeborg Maus
Ingeborg Maus
Jemand, der keine Strandlektüre schrieb
zusammenfasst, wäre heute überhaupt nur erfüllbar, wenn es in
den sozialen Sphären komplementäre Demokratien gäbe.
7
Denn nur so ließe sich in einer funktional differenzierten
Gesellschaft sicherstellen, dass sich das gemeinschaftliche
Interesse in den Regeln abbildet, die das Leben insgesamt
anleiten. Wie wir arbeiten, wie wir wohnen, was wir verbrauchen
und wie wir vorsorgen, das sind keine Nebensächlichkeiten im
Leben. Es sind systemische Elemente, deren Arrangement über das
Schicksal der Gesellschaft entscheidet. Und doch werden hier die
Spielregeln nicht durch den Mehrheitswillen geprägt, sondern
durch trübe Partikularinteressen. Die Folge davon ist eine
Ohnmacht, ja eine Entfremdung, die Gesellschaft als Spielball
von Sachzwängen erscheinen lässt.
8
Dass wir
selbst oder auch nur unsere politischen Repräsentanten einen
Zugriff auf die sozialen Umstände haben, die unserem Leben,
unserer Zukunft den Stempel aufdrücken, spüren nur wenige. Das
macht uns zu Flugsand, der hilflos von der Geschichte
davongetragen wird.
9
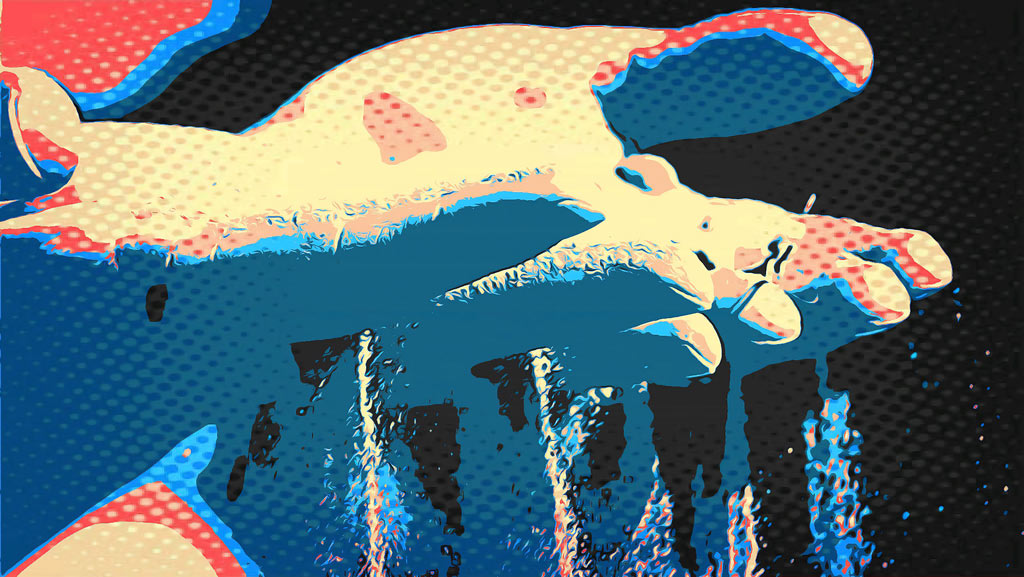
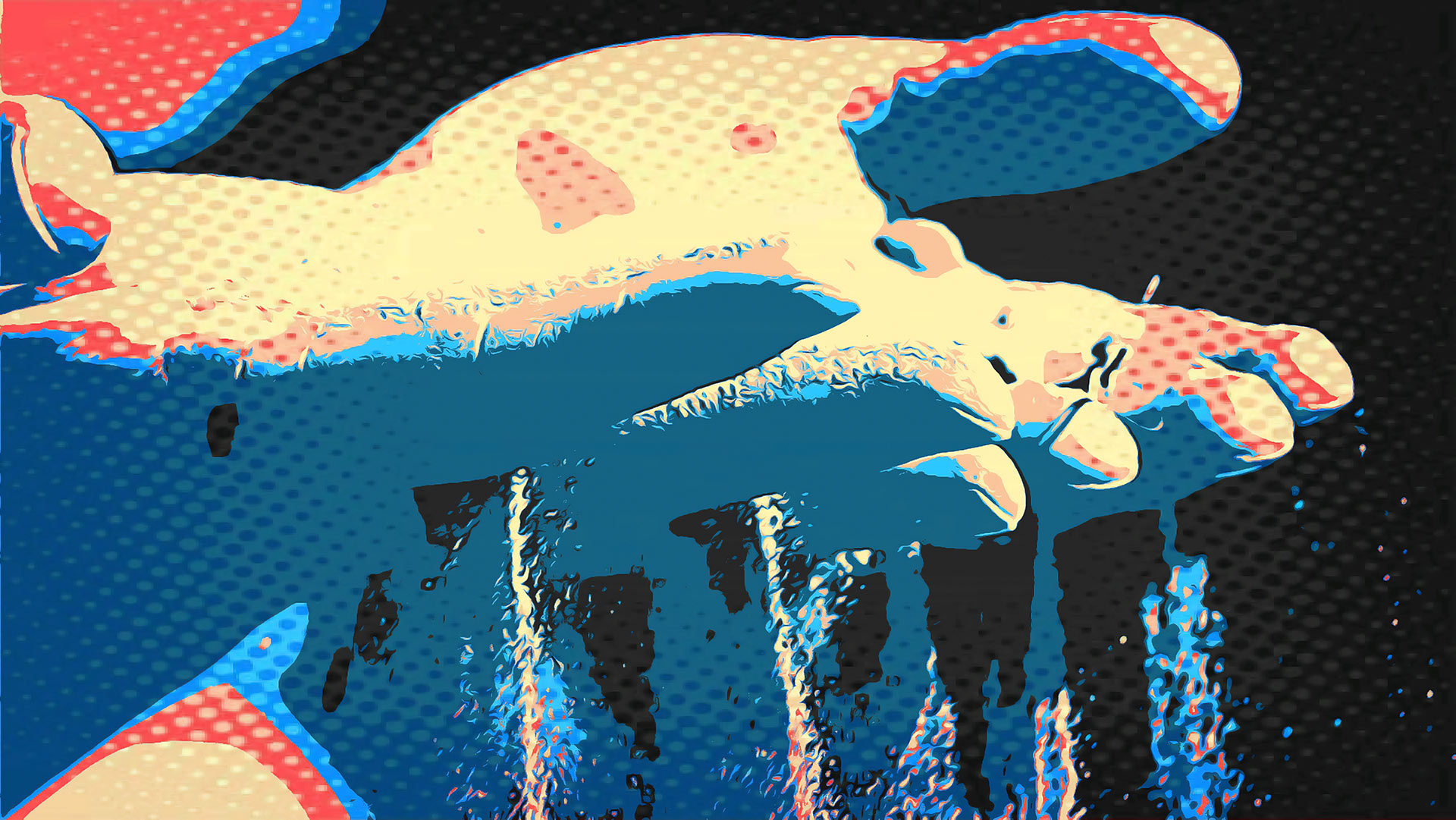
Dabei leben wir in Zeiten, wo der liberale Staat ohnehin schon
an die Eigenverantwortung einer diffusen Masse appellieren muss,
um das angeblich Schlimmste abzuwenden.
10
Da
wäre es nur folgerichtig, jene Verantwortung auch zu
institutionalisieren, wenn kein aufgescheuchter Hühnerhaufen die
Folge sein soll. Seiner kollektiven Verantwortung kann ein
sozialer Organismus eben nur gerecht werden, wenn er
Repräsentationen hat, über die er sich artikulieren,
verständigen, koordinieren und letztlich steuern kann.
11
Ob dies gleich ganze Sozialparlamente sein können, die das
allgemeinpolitische Parlament zu einer Art Mehrkammersystem
erweitern, wird sich noch klären. Hier ist zunächst einmal zu
erwägen, inwiefern eine Erweiterung der politischen Bürgerschaft
um soziale Bürgerschaften Schwung in die Demokratie bringen
könnte.
12
Denn der unizentrische
Parlamentarismus kennt zwar
föderale Untergliederungen,
Föderalismus
Ein Organisationsprinzip, das aus seinem Schatten treten muss
die politische Variabilität ermöglichen sollen. In seiner
marktförmigen Einbettung bringt er insgesamt aber eine
Wissensordnung hervor, die politische Monotonie
befördert.
13
Zum einen ist diese durch die
uniformierenden Karrierewege der politischen Klasse bedingt, die
wie bei Profifußballern häufig in Bahnen verlaufen, die wenig
Bezug zu den sozialen Wirklichkeiten der Masse zulässt.
14
Zum anderen folgt sie der sozialen Zusammensetzung jener Klasse,
die natürlich die Perspektive einer eher privilegierten
Bevölkerung repräsentiert.
15
»Dem herkömmlichen Parlamentarismus fehlt es an einer spezialisierenden Funktionsteilung, die der Komplexität der sozialen Probleme entspricht. Auch deswegen wird das Soziale nicht von der Politik gestaltet, sondern vielmehr in seiner Feudalhaftigkeit verwaltet.«
Die Stromlinienförmigkeit der Politik, in die sich vor allem
karrierebewusste Typen gut einfügen, fällt zusammen mit der
schon erwähnten Grobheit einer bloß politischen Demokratie. Die
Tendenz zur sozialen Sehschwäche trifft hier auf einen
schwerfälligen Entscheidungsapparat, der zu einer wirklichen
Sozialpolitik kaum in der Lage ist. Im Grunde absorbiert die
Politik mit der Vermittlung zwischen den pluralen Weltsichten
bereits seine Leistungsfähigkeit.
16
Denn für
die Vermittlung zwischen den sozialen Widersprüchen – oder gar
ihre Aufhebung – fehlt es dem herkömmlichen Parlamentarismus an
einer spezialisierenden Funktionsteilung, die der Komplexität
der sozialen Probleme entspricht. Auch deswegen wird das Soziale
nicht von der Politik gestaltet, sondern vielmehr in seiner
Feudalhaftigkeit verwaltet. Zum anderen ist dies freilich auch
der Fall, weil der politische Liberalismus – zurecht – davor
zurückschreckt, den Staat aktiv in die sozialen Sphären
eingreifen zu lassen, um eine polit-ökonomische Gewaltenballung
wie in kommunistischen Staaten auszuschließen.
17
Wo aber die Sphären eine soziale Selbstverwaltung entwickeln,
wäre gar das Gegenteil der Fall: Es wäre eine neue
Gewaltenteilung
Gewaltenteilung
Das Funktionsprinzip, das ein Gemeinwesen geschmeidig macht
geschaffen, bei der die politische Repräsentation nicht einfach
nur Macht oder Verantwortung an soziale Repräsentationen abgäbe.
Es ließen sich dann auch endlich die sozialen Sphären durch
funktional spezialisierte Organe der Gemeinschaft
ausgestalten.
18


Die Idee eines solch feingliedrigen Repräsentationssystems mag
ungewohnt sein. Sie fordert unser grobschlächtiges
Demokratieverständnis heraus. Und doch hat sie eine lange
Vorgeschichte, angefangen im 19. Jahrhundert, als
republikanische und sozialistische Gedanken noch nah beieinander
waren. In beiden Denkströmungen formierte sich damals Kritik an
einer nur allgemeinpolitisch gedachten Demokratie; und in beiden
Strömungen wurde eine Art Gewerkschaftssozialismus vorgedacht,
der letztlich in der
Ersten Internationale
Erste Internationale
Ein Begriff, der eine Positionierung verlangt
Form annahm.
19
Auf deren Kongress 1869 in
Basel exponierte sich eine Fraktion, die den
»Zentralisations-Staat« durch multiple »Repräsentationen der
Arbeit« ersetzt sehen wollte, so dass verschiedene
Wirtschaftsbereiche »für sich eine Art Staat bilden«.
20
Ein solch »industrieller Staat« , wie
August Willich
August Willich
Jemand, der die Republik in andere Sphären tragen wollte
jene Ordnungsform zuvor schon bezeichnet hatte,
21
sollte vor allem auf den Gewerkschaften aufbauen.
22
Sie rief man damit zur Keimzelle einer neuen Ordnung aus. In der
Internationale wurde diese Position von den Föderalisten
vertreten, aus denen letztlich der Anarchismus hervorging. Von
Marx & Co. besonders harsch bekämpft,
23
wurden deren Ideen später von der revolutionären
Gewerkschaftsbewegung, also dem Syndikalismus,
aufgegriffen.
24
Insofern dieser für den
Versuch stand, das politische Handeln in das Soziale bzw.
Ökonomische zu verlagern, war hier der Gedanke einer sphärischen
Differenzierung zumindest angelegt.
Wie große Teile der Arbeiterbewegung krankte der Syndikalismus
aber an der Vorstellung, die Neuordnung der wirtschaftlichen
Sphäre würde einen allgemeinpolitischen Überbau überflüssig
machen. Er blendete damit aus, wie es die Gegenkritik innerhalb
der Internationale – auch hier zurecht – formulierte, dass
Menschen doch nicht nur ihrem Beruf verbunden seien. Sie seien
eben auch Bürger, die noch viele andere Belange der Gemeinschaft
zu klären haben.
25
Positionen wie die des
Frühanarchisten
César De Paepe,
César De Paepe
Jemand, der den Staat anarchistisch wenden wollte
dass der bürgerliche Staat nicht abzuschaffen, sondern zu
transformieren sei,
26
kamen dagegen lange
nicht an.
27
Aufgelöst wurde diese
produktivistische Verengung vom sogenannten Gildensozialismus,
dessen reichhaltige Überlegungen kaum bekannt sind.
28
Hier sprach man in der Tat von einer »funktionalen Demokratie«,
in der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch andere
Funktionsbereiche des Gemeinwesens einer sozialen
Selbstverwaltung unterstellt würden.
29
Wenngleich auch die Gildensozialisten uneinig darin waren, bis
zu welchem Grad ein solch multizentrisches Repräsentationssystem
eine politische Zentrale entbehrlich mache,
30
so war für ihre Demokratietheorie doch ein Gedanke
charakteristisch: Da jeder Bürger eine Vielzahl von sozialen
Willen verkörpere, könne echte Repräsentation nicht allgemein,
sondern nur in spezifischen Funktionsbereichen
erfolgen.
31
In Sphären eben.

